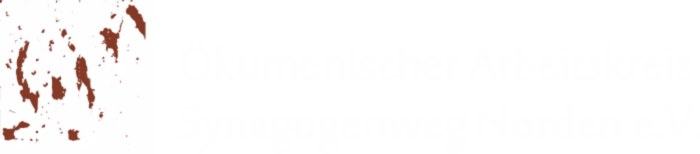Stolpersteine sind pflastersteingroße viereckige Betonsteine (9,6 cm x 9,6 cm) mit einer Oberfläche aus Messing. In diese Messingtafeln sind die Namen und Daten der Menschen graviert, die in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, deportiert, ermordet wurden. Die Steine werden in der Regel vor dem letzten freigewählten Wohnsitz dieser Menschen in den Bürgerstein eingelassen, entweder vor dem Originalgebäude oder - falls möglich - vor seinem alten Standort. Bis Ende 2014 wurden etwa 50.000 Stolpersteine in Deutschland und 17 weiteren europäischen Ländern verlegt. In Norden wurden die ersten Steine am 17.Juli 2009 eingeweiht.
1990 zeichnete der Kölner Künstler Gunter Demnig anlässlich des 50. Jahrestages der Deportation von 1000 Sinti und Roma aus Köln im Mai 1940 mit einer Farbspur ihren Deportationsweg zum Bahnhof Deutz nach. In der Auseinandersetzung mit der Geschichte der Verfolgten des nationalsozialistischen Regimes entwickelte Demnig in den folgenden Jahren das Projekt der Stolpersteine. Dabei berief er sich auf den Talmud, eine der bedeutendsten Schriften des Judentums, in der sich die Worte finden: "Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist".
Heute ist das Projekt das größte dezentralen Mahnmal der Welt.
Es gibt allerdings auch kritische Stimmen, vor allem aus jüdischen Kreisen. So wehrt sich die ehemalige Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, Charlotte Knobloch, dagegen, dass die Steine in den Boden eingelassen werden und dadurch mit den Füßen auf den Namen herumgetreten werde.
Hergestellt werden die Steine in Handarbeit von Michael Friedrichs-Friedländer in seinem Atelier in Berlin-Pankow (Näheres unter http://www.projekt-stolpersteine.de/ ).
Voraussetzung für die Anfertigung und Verlegung eines Stolpersteins ist eine sorgfältige Recherchearbeit, um das Schicksal eines verfolgten, deportierten oder ermordeten Menschen auf den kleinen Messingtafeln zu zeigen. Mit den Stolpersteinen vor den Hausfronten soll die Erinnerung an die Menschen lebendig werden, die hier gelebt haben. Die Inschriften beginnen immer mit den Worten "Hier wohnte..."
Die Kosten für einen Stolperstein liegen derzeit (Stand 2015) bei 120 €; sie finanzieren sich aus Spenden. Wie in anderen Städten arbeitet auch die Ökumenische Arbeitsgruppe Synagogenweg in Norden daran, weitere Schicksale jüdischer Mitbürger zu erforschen und ihnen mit der Verlegung eines Stolpersteins zu gedenken.
Gerade in unserem norddeutschen Klima laufen die Oberflächen der Steine schnell an und werden unansehnlich. Damit die Stolpersteine im Neuen Weg, in der Uffen-, Herings- und Sielstraße sowie im Synagogenweg auch weiterhin wahrgenommen werden können, ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Für einige Steine gibt es bereits sogenannte „Putzpaten“, die diese Aufgabe übernommen haben. Die Ökomenische Arbeitsgruppe Synagogenweg sucht dringend weitere Mitbürger, die bereit sind, sich um einen oder mehrere Steine zu kümmern. Wer Interesse hat, melde sich bitte unter der Telefonnummer 04931/957818.
Im Juli 2009 nahm eine Schülergruppe des Ulrichsgymnasiums an der feierlichen Verlegung der ersten Norder Stolpersteine teil. In ihren Vorträgen zum Schicksal der jüdischen Familie Wolff aus der Brückstraße 7 beschäftigten sie sich auch mit der Frage, warum junge Menschen sich mit der dunklen Vergangenheit ihres Wohnortes auseinandersetzen sollten. Im Folgenden sind die Worte der Gruppe abgedruckt:
"Warum war uns die Mitarbeit an dem Projekt Stolpersteine so wichtig?
Sie haben jetzt gehört, welches Schicksal Gerda [Wolff] und ihrer Familie widerfahren ist. Aber wir denken, dass auch Menschen, die die persönliche Geschichte dieses Mädchens nicht kennen, eine Vorstellung von den Verbrechen der Nationalsozialisten an der Familie Wolf und Millionen anderer Juden haben.
Vor diesem Hintergrund ist es uns wichtig, dass den Opfern zumindest nach ihrem Tod ein Teil ihrer Würde zurückgegeben wird und dass aus KZ-Nummern wieder Namen werden.
„Gegen das Vergessen“ – das war unser zentraler Satz beim Spendenaufruf und er bildet gleichzeitig unser wichtigstes Ziel: Passanten sollen im wahrsten Sinne des Wortes über diese Steine stolpern, einen Augenblick innehalten und dem Schicksal von Gerda und ihrer Familie gedenken. So werden diese fünf Menschen nicht vergessen.
Denn vergessen werden soll und darf auf keinen Fall, was dem jüdischen Volk im Holocaust auch in Norden angetan wurde."
"Ich bin Mitglied der Gruppe „Stolpersteine“, weil ich nicht möchte, dass das Holocaust-Verbrechen in Vergessenheit gerät.
Wenn ein Freund oder ein Verwandter stirbt, schließt man damit ja auch nicht einfach ab. Man besucht und pflegt das Grab und denkt besonders an Feiertagen an den Verstorbenen.
Nun könnte man zwar sagen „Ich habe doch gar nicht in der Zeit des Nationalsozialismus gelebt und kenne außerdem keinen der 6 Millionen Juden“. Verständlich, wie ich finde. Aber was würde aus dieser Welt werden, wenn alle so denken würden?
Deshalb machen wir einen Anfang, damit auch dieses dunkle Kapitel der deutschen Geschichte und vor allem die vielen unschuldigen Menschen, die ermordet wurden, nicht vergessen werden.
Jeder von uns soll, wenn er über einen Stolperstein „stolpert“, an die Juden, Sinti und die vielen anderen Opfer des nationalsozialistischen Regimes denken – und wenn es nur für ein paar Sekunden ist - und ihnen die letzte Ehre erweisen.
Wir hoffen, dass wir auf diesem Wege etwas erreichen. Und vielleicht nicht nur für die Verstorbenen, sondern auch dafür, dass wir in dieser hektischen Welt ein wenig mehr auf die Bedürfnisse anderer Menschen eingehen und sie mit Respekt behandeln."
Ökumenischer Arbeitskreis Synagogenweg Norden e.V.
Synagogenweg 4
26506 Norden
info@ak-synagogenweg.de